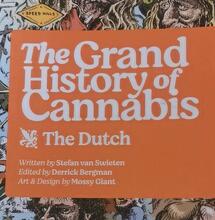Modellprojekte auf der Kippe
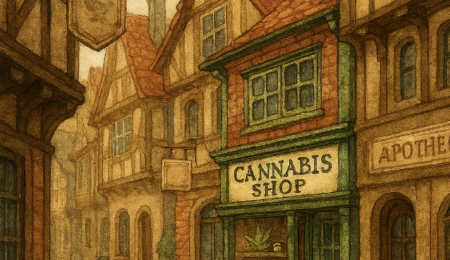
Die Euphorie rund um die Cannabislegalisierung in Deutschland ist spürbar abgekühlt. Während Cannabis Social Clubs (CSCs) vielerorts bereits aktiv sind, geraten die geplanten Modellprojekte zur kommerziellen Abgabe zunehmend ins Stocken. Ablehnungen durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), politische Blockaden und rechtliche Unsicherheiten werfen Fragen zur Umsetzbarkeit und Zukunft der zweiten Säule des Konsumcannabisgesetzes (KCanG) auf.
Status quo der CSCs
Seit dem 1. Juli 2024 dürfen in Deutschland Cannabis Social Clubs gegründet werden. Laut einer aktuellen Umfrage unter 220 Anbauvereinigungen liegt die durchschnittliche Mitgliederzahl bei 275 Personen. Die Clubs geben im Schnitt 22,6 g Cannabis pro Mitglied und Monat ab, mit einem THC-Gehalt von rund 18,6 %. Trotz dieser positiven Zahlen gibt es Kritik an der Umsetzung: Genehmigungsverfahren sind langwierig und uneinheitlich zwischen den Bundesländern.
In konservativen Regionen wie Bayern ist die Zahl der genehmigten Clubs besonders niedrig. Viele Clubs beklagen überzogene Auflagen und mangelnde Rechtssicherheit. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Nachfrage nach legalem Cannabis groß ist – und dass viele Konsumenten bereit wären, sich in einem Club zu organisieren, wenn die bürokratischen Hürden nicht so hoch wären.
Zwischen Vision und Stillstand
Die zweite Säule der Legalisierung – regionale Modellprojekte mit kommerziellen Lieferketten – sollte eigentlich wissenschaftlich begleitet Erkenntnisse über Konsumverhalten, Schwarzmarktverdrängung und Jugendschutz liefern. Doch die Realität sieht ernüchternd aus: Die BLE hat bislang keinen einzigen Antrag genehmigt, aber bereits sechs abgelehnt. In Frankfurt und Hannover wurde ein gemeinsames Projekt mit der Sanity Group gestoppt – trotz wissenschaftlicher Begleitung durch die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und die Frankfurt University of Applied Sciences. Die BLE begründet ihre Ablehnung mit der fehlenden gesetzlichen Grundlage in der aktuellen Fassung des KCanG.
Auch ein Projekt in Mittelholstein wurde mit Verweis auf 14 formale Mängel abgelehnt. Insgesamt liegen über 60 Forschungsvorhaben zur Prüfung bei der BLE, doch die Bearbeitung scheint schleppend zu verlaufen. Ein offener Brief deutscher Wissenschaftler fordert die Bundesregierung auf, die Forschungsvorhaben endlich zu genehmigen. Ohne diese Studien sei keine evidenzbasierte Drogenpolitik möglich. Die Verzögerungen gefährden nicht nur die wissenschaftliche Begleitung, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Legalisierungspolitik insgesamt.
Fazit
Während CSCs trotz bürokratischer Hürden langsam Fuß fassen, droht die zweite Säule der Legalisierung zu scheitern, bevor sie überhaupt begonnen hat. Die BLE agiert restriktiv, politische Rückendeckung fehlt, und die dringend benötigte Forschung bleibt auf der Strecke. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, droht Deutschland seine Vorreiterrolle in Europa zu verspielen – und der Schwarzmarkt bleibt der lachende Dritte.



_11zon.jpg)







_0.png)